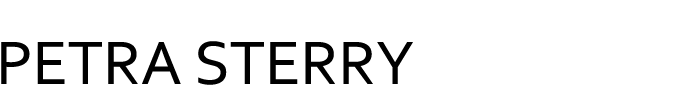Bewusstsein ist verkörpert
Petra Sterry im Gespräch mit Thomas Fuchs, Karl-Jaspers-Professor für Philosophie und Psychiatrie, Leiter der Sektion „Phänomenologische Psychopathologie und Psychotherapie“, Klinik für Allgemeine Psychiatrie, Heidelberg
Petra Sterry (PS): In den letzten Jahren habe ich mich in meiner Arbeit sehr intensiv mit den inneren Zuständen des Menschen und mit Emotionen auseinandergesetzt. Dabei hat sich gezeigt, dass die Methode, die ich anwende, nämlich die der Introspektion, wesentlich ist, um über Gefühle und über das innere Erleben etwas sagen zu können. Es ist der Blick aus der eigenen, aus der subjektiven Perspektive, durch den ich die Welt erfahren und beschreiben kann. Wie definieren Sie Subjektivität, und warum ist Subjektivität so wichtig?
Thomas Fuchs (TF): Damit haben Sie natürlich schon eine Grundfrage der Philosophie aufgeworfen, die sich wirklich nicht in einer Definition einfach beantworten lässt, das muss ich vorsichtshalber vorausschicken. Subjektivität bezeichnet die Tatsache, dass sich das Erleben und das Bewusstsein nur findet gebunden an ein Zentrum von Erleben, an ein Zentrum von Bewusstheit, dass also alles, was erlebt wird, für ein Subjekt erscheint, und dass das Subjekt sozusagen der Bezugspunkt, der Referenzpunkt allen Erlebens ist. Subjektivität ist in diesem Sinne auch als Zentralität zu fassen. Das heißt, die Bezogenheit allen Erlebens auf ein Zentrum, von dem aus Erlebens- und Bewegungsrichtungen ausstrahlen, auf das aber auch die Affektionen, die Wahrnehmungsrichtungen von außen einstrahlen. So würde ich es einmal versuchsweise formulieren. Subjektivität ist damit Voraussetzung für alles Erleben. Es gibt kein anonymes Erleben, kein anonymes Bewusstsein, und Subjektivität geht insofern auch immer einher mit einem Selbsterleben. Das Zentrum des Erlebens ist nicht nur sozusagen ein geometrischer Punkt, sondern was erlebt wird, ist „für mich“, und ich bin mir meiner selbst im Erleben inne. Wenn ich Sie also jetzt auf dem Bildschirm sehe, mit Ihnen in Kontakt bin, dann kann ich ganz in meinen Worten und im Gespräch mit Ihnen aufgehen. Trotzdem bleibt immer ein Zentralitätsgefühl, ein Selbstempfinden, das das Ganze begleitet und einfasst. Ich verschwinde nicht im Erleben, im Wahrgenommenen oder in meinen Gedanken, sondern es bleibt immer ein letztlich auch leibliches Selbsterleben im Hintergrund, das diese Wahrnehmungen und Handlungen, dieses Sprechen gewissermaßen trägt. Also ist Subjektivität kurz zusammengefasst Zentralität, Perspektivität allen Erlebens, und es ist zugleich Selbstsein, Selbst-Innesein allen Erlebens.
Mehr lesen / Read more ...PS: Jetzt ist es aber auch so, dass das Erleben keine solipsistische Erfahrung ist. Das heißt, ich muss in Relation zu anderen sein, auch in Relation zu Dingen und Sachverhalten, um die Welt wahrnehmen zu können. Im Prinzip ist Subjektivität auch verbunden mit einer gewissen Intersubjektivität.
TF: Ja, da haben Sie völlig Recht – Subjektivität ist immer relational zu fassen. Es ist immer Bezogensein auf etwas. Subjektivität überschreitet sich fortwährend in der Bezogenheit zur Welt. Das hab ich vorhin ausgedrückt, als ich sagte, ich bin jetzt engagiert in dem Gespräch, im Wahrnehmen unserer Interaktion und Ihrer Person; das heißt, ich überschreite meine Eigensphäre immer in Kontakt und in Beziehung zur Welt. Ein Stück Selbsttranszendenz liegt in jeder Subjektivität. Das ist also eine Relation, eine Bezogenheit auf die Welt, wie sie mir jeweils gegeben ist und erscheint. Zu dieser Welt gehören aber ganz besonders andere Subjekte, und die Intersubjektivität ist sogar all meinem Erleben inhärent, weil ich, selbst wenn gerade niemand da wäre, doch alles, was ich erlebe und wahrnehme, immer auch unter dem Gesichtspunkt erlebe, dass es auch andere Subjekte gibt, dass es auch Andere gäbe, die das Gleiche mit mir wahrnehmen könnten. Also die Intersubjektivität ist gewissermaßen „eingebaut“ oder eingeschlossen in all mein Erleben. Selbst wenn Robinson Crusoe auf seiner Insel keine anderen Menschen um sich herum gehabt hat, dann sah er diese Insel trotzdem immer mit den Augen anderer, weil er implizit davon ausging, jeder, der mit ihm gestrandet wäre, würde die gleiche Wahrnehmung machen. Wahrnehmung ist für uns Menschen immer eine potenziell gemeinsame Wahrnehmung.
PS: Das heißt also, dass wir, obwohl wir subjektiv erleben, gleichzeitig auch die Fähigkeit haben zu objektivieren. Wir können uns in andere hineinversetzen. Und das ist sicher auch wichtig, denn sonst wäre es vielleicht gar nicht möglich, Empathie zu entwickeln. Ich glaube, Empathie ist wichtig, um eine Möglichkeit der Abstufung allen Erlebens und Wahrnehmens zu haben.
TF: Sie haben ganz Recht: Intersubjektivität, also das Überschreiten oder immer schon Überschrittenhaben der reinen Selbstsphäre, das, was Heidegger das „Mitsein“ genannt hat, konzentriert sich noch einmal in der konkreten Empathie, also der Fähigkeit, mit anderen Subjekten in ein gemeinsames Erleben einzutreten, das vor allem auf der Zwischenleiblichkeit beruht. Also darauf, dass wir den Ausdruck und das Verhalten Anderer als beseelt, als belebt wahrnehmen und im lebendigen, verkörperten Kontakt mit ihnen primäre Empathie möglich wird. Primäre Empathie ist in meinem Verständnis die unmittelbare Mitempfindung des Ausdrucks des anderen, der Gefühlsdynamik, die darin mitschwingt, des Blickes und anderer Äußerungen , die eine Richtung aufweisen, die eine Belebtheit, eine Absicht, eine Intention zeigen. Wenn Sie mich hier zu einer Tasse greifen sehen, können Sie unmittelbar mitwahrnehmen, dass ich aus dieser Tasse trinken möchte. Diese Absicht und diese Intention zu trinken können Sie wahrnehmen; dazu brauchen Sie nicht zusätzliche Gedanken über mich und meine mögliche Innenwelt, sondern das ist einfach als intentionales Verhalten für Sie sichtbar. Nun kommt aber beim Menschen noch eine zusätzliche Ebene von Empathie ins Spiel, die sich dadurch ergibt, dass wir uns ja auch noch in Andere hineinversetzen können. Wir können die Perspektive der anderen übernehmen, sodass sich also über die primäre Ebene des unmittelbaren Wahrnehmens und Verstehens nochmal eine Ebene legt, in der wir uns aktiv vorstellen oder fragen können, was mit dem anderen ist, was ihn bewegt, was seine Vorerfahrungen sind, wie es mir an seiner Stelle gehen würde usw. Das sind also zusätzliche, eher kognitive Möglichkeiten, die wir haben, uns in andere hineinzuversetzen und einzufühlen. Diese spezielle Form von Empathie haben höhere Säugetiere nicht, während sie die primäre des wechselseitigen Mitempfindens bis zu einem gewissen Grad wohl mit uns teilen.
PS: Ich habe mich in meiner Arbeit sehr mit Gefühlen beschäftigt, und mich hat dabei interessiert, wie kann man über Angst sprechen, über Freude, aber auch über Unbehagen. Mir ist klar geworden, dass es einfach nicht anders geht, als sich dabei selbst zu beobachten und das auch am Körperlichen festzumachen. Aber nicht nur am Körperlichen, sondern auch am Leiblichen. Sie schreiben vom Doppelaspekt des Physischen, nämlich dem Leib als Natur, die wir sind, und dem Körper als Natur, die wir haben. Wie hängt dieser Doppelaspekt zusammen? Wie lässt sich das Körperliche mit dem Leiblichen in ein Ganzes bringen, wie lässt sich diese Entität beschreiben?
TF: Auch das ist eine höchst schwierige Frage, weil es das Leib-Seele-Problem betrifft, aber ich würde es so formulieren: Wir sind als Menschen in der besonderen Situation, nicht einfach nur leiblich mit der Welt in Kontakt zu sein, zwischenleiblich mit anderen zu interagieren, sondern uns dieses leiblichen Verhältnisses zur Welt selbst noch einmal bewusst sein zu können, dazu noch einmal Stellung zu nehmen. Wir haben das, was Helmuth Plessner einmal die exzentrische Position des Menschen genannt hat. Wir können bei allem, was wir tun – auch wenn wir es zunächst mal ganz unreflektiert und spontan tun – immer ein Stück von außen beobachten und eine zusätzliche Außensicht auf uns selbst einnehmen. Dadurch entsteht aber ein ganz anderes Verhältnis zu unserem Leib. Denn unser Leib wird dadurch auch zu einem Körper, der ja unter anderen Körpern existiert, der von außen wahrgenommen oder auch untersucht werden kann, den man also dem Arzt zeigen kann, damit er ihn diagnostisch abhört und abklopft. Damit entsteht ein Körper, den ich habe, den ich von außen sehen kann; bis dahin, dass wir in der Lage sind, diesen Körper wissenschaftlich zu erforschen usw. Das ist also ein ganz anderes Verhältnis zum Leib, das da entsteht. Jetzt haben wir dieses merkwürdige Phänomen, dass ich einerseits dieses leibliche Wesen bin, das jetzt spricht, sich bewegt, gestikuliert und sich erlebt. Trotzdem gibt es ja auch gleichzeitig mich als Körper, und ein Physiologe oder Neurowissenschaftler könnte jetzt sehr genau hinsehen und meine Muskelbewegungen, meine Gehirnströme, meine neuronalen Aktivitäten untersuchen, und das würde natürlich alles gleichzeitig zu meinem Sprechen ablaufen, allerdings mit dem Nebeneffekt, dass von meinem Erleben darin nichts mehr zu finden ist. Das ist dann verschwunden. Der Neurowissenschaftler kann zwar die neuronalen Aktivitäten in meinem Kopf genau untersuchen, aber mein Erleben ist ihm damit nicht gegeben. Jetzt haben wir diese eigentümliche Doppelheit: Ich bin dieses lebendige Wesen, das da spricht, das sich erlebt, das Sie erleben. Gleichzeitig laufen aber noch alle körperlichen Prozesse ab, die offenbar ja auch dazu notwendig sind, dass ich zu Ihnen sprechen kann. So, und wie hängt nun das Ganze zusammen? Ganz genau weiß es niemand. Sicher ist aber, es gibt mich nur einmal. Ich bin hier vor Ihnen, sitze da, und meine physiologischen Prozesse, also die körperlichen Prozesse sind sicher nicht etwas ganz anderes, und sind sicher nicht in einer anderen Welt als das, was ich jetzt erlebe, wie ich zu Ihnen spreche, und wie Sie mich wahrnehmen. Wir haben also zwei verschiedene Einstellungen, zwei verschiedene Aspekte auf ein und dasselbe, nämlich auf die lebendige Person, die ich eben bin.
PS: Sie schreiben in Ihrem Buch „Das Gehirn – ein Beziehungsorgan“, dass es eine Koextension von Körper und Leib gibt. Sie teilen das auf in den subjektiv-leiblichen Raum und den körperlich-objektiven Raum. Und Sie sagen auch, dass das leiblich-affektive Empfinden die Basis ist für Bewusstseinsprozesse ist. Jetzt ist es aber so, dass es andere Erklärungsmodelle gibt, die sagen, dass das Bewusstsein nur auf neuronalen Prozessen beruht. Es ist aber doch das intentionale Erleben, das das Selbstbewusstsein und auch die Handlungsfähigkeit des Menschen ermöglicht. Was ist das stärkere Argument, das für die Subjektivität spricht?
TF: Zunächst mal ist das stärkste Argument für die Subjektivität die Tatsache, dass sich in neuronalen Prozessen, also aus der Beobachtung von objektiv vorhandenen physiologischen Prozessen keinerlei Hinweis, keinerlei Übergang finden lässt zu so etwas wie Erleben. Sie können noch so lange in das Gehirn hineinsehen, Sie können die Prozesse dort beliebig detailliert beobachten, nirgendwo werden Sie dort auf so etwas wie Erleben treffen. Diese reine Äußerlichkeit, die naturwissenschaftliches Erforschen kennzeichnet, dass also von allem Erleben, von allem Qualitativen vollkommen abgesehen wird, diese reine Äußerlichkeit kann schon per se niemals zu so etwas wie Subjektivität gelangen. Sie kann höchstens Voraussetzungen feststellen, die notwendig sind dafür, dass bewusstes Erleben auftritt. Sie kann aber dieses Erleben selbst nicht auf neuronale Prozesse reduzieren, weil es in den neuronalen Prozessen gar nicht zu finden ist. Wenn ein Neurowissenschaftler einen Menschen untersucht, von dem man nicht weiß, ob er bei Bewusstsein ist oder nicht, dann kann er anhand der Untersuchung von Gehirnfunktionen schlicht und einfach nicht feststellen. Es gibt keine Möglichkeit, neuronalen Prozessen anzusehen, ob sie mit Bewusstsein verbunden sind oder nicht. Die einzige Möglichkeit, die er dazu hat, ist mit dem Betreffenden zu interagieren, ihn also wieder als vollständiges Lebewesen zu befragen, seine Reaktionen wahrzunehmen und dabei die begleitenden Hirnprozesse zu untersuchen. Aber die Subjektivität lässt sich aus den Hirnprozessen alleine gar nicht erschließen. Das also ist die grundsätzliche Beschränkung des physiologischen Herangehens. Dazu kommt noch das Problem, dass die reine Untersuchung von Gehirnfunktionen die Verkörperung des Gehirns, also den Zusammenhang von Gehirn und Organismus vollständig unterschlägt. Das ist aber ein Ausschnitt, eine Begrenzung, die einer biologischen Betrachtung des Organismus nicht standhält, weil – das habe ich in meinem Buch ausführlich gezeigt – schon die basalen Bewusstseinsprozesse immer auf Rückkoppelungen, auf Verbindungen von Gehirn und Organismus beruhen, so das Gehirn sich nicht abtrennen lässt, so als ob in ihm alleine Bewusstsein stattfinden würde. Das ist allerdings eine auch biologisch schwierige Nachweiskette, die ich jetzt hier nicht ausführen kann.
PS: Sie bezeichnen es als Kategorienfehler, dass dem Gehirn Autonomie zugesprochen wird. Könnten Sie das genauer erklären?
TF: Der Kategorienfehler liegt darin, dass einem Teilorgan das zugesprochen wird, was nur einem Organismus, einem Lebewesen zugesprochen werden kann. Eigentlich ist das relativ klar bei allen Handlungen: Wenn Sie sagen, ein Mensch geht über die Straße, um auf die andere Seite zu kommen, dann ist es völlig klar, dass diese Handlung dem ganzen Menschen zugeschrieben werden muss. Es ist ja nicht sein Gehirn, das über die Straße läuft oder über die Straße gehen will, sondern es ist die Person in ihrer lebendigen Ganzheit, die diese Handlung vollzieht. Wenn man nun sagt, aber das Gehirn ist doch das, was handelt, das Gehirn ist das, was will, und was die Bewegung macht, dann reduziert man den Lebensvollzug auf ein Teil, also auf ein Teilorgan. Und das ist ein sogenannter „mereologischer Fehlschluss“, ein Kategorienfehler, der ein Teil an die Stelle des Ganzen setzt. Um über die Straße zu gehen, brauchen Sie einen ganzen, lebendigen Organismus. Das Gehirn hat keine Füße. Wenn man trotzdem sagt, das Gehen ist ein Prozess, der dem Gehirn zugeschrieben werden muss, ist dies ein Kategorienfehler, weil man einem Teilorgan etwas zuschreibt, was nur die gesamte Person vollziehen kann. Das gilt aber auch für das Wahrnehmen. Auch Wahrnehmen braucht die Sinnesorgane und den Körper, und das Gleiche gilt sogar am Ende fürs Denken. Auch das Denken kann man nicht dem Gehirn zuschreiben, weil alles Denken sich auf dem Hintergrund eines Erlebens vollzieht. Um denken zu können, muss ich zunächst mal bewusst sein. Und um bewusst zu sein, muss ich leiblich spüren, also ein leibliches Erleben haben, und dieses Erleben ist an den ganzen Körper gebunden. Also das Denken, das das klassische „reine Bewusstsein“ zu sein scheint, ist nicht ein Prozess in einem Teilorgan des Körpers, sondern auch das Denken ist eingebettet in einen Lebensvollzug, in Lebendigkeit, und die erfordert wieder den ganzen Organismus.
PS: Also das Ganze ist mehr als die Summe der Teile. Der Leib ist aber auch ein Resonanzraum für Stimmungen und Gefühle. Und Stimmungen und Gefühle sind auch wie Sensoren, wie Regler, die ermöglichen, dass der Mensch sich in der Welt zurechtfindet, dass er sich durch die Widerfahrnisse des Lebens navigieren und das eigene Leben gestalten kann. Warum sind Emotionen Ihrer Meinung nach so wichtig?
TF: Emotionen sind die Formen des Erlebens, die uns vermitteln, was für uns bedeutsam, was für uns relevant ist, was uns angeht. Was also im weitesten Sinne die Grundlage dafür ist, dass wir in der Welt überhaupt auf etwas hinaus wollen. Gefühle sagen uns, welche Situationen für uns relevant sind, und wie wir auf sie reagieren sollen. Das kann das kognitive Denken alleine nicht beantworten. Die Kognitionen, also die Gedanken, die wir uns über Situationen machen, würden uns niemals sagen, worauf es uns tatsächlich ankommt. Erst wenn wir von einer Situation leiblich und affektiv betroffen sind, können wir spüren und dann auch umsetzen, was uns in dieser Situation wichtig ist, und wie wir handeln sollen. Alles was wertvoll ist, was attraktiv ist, oder was zu vermeiden ist, lässt sich nur über Gefühle erfassen, das können uns Gedanken niemals sagen. Und da wir nun einmal Lebewesen sind, die in einer Welt überleben sollen und überleben wollen, müssen wir diese Relevanzen, also das, was uns wichtig ist, fortwährend spüren. Das ist nur über Gefühle möglich.
PS: Sie zitieren Galen Strawson: „Bedeutung hat immer damit zu tun, dass etwas für jemanden etwas bedeutet.“ Das zeigt auch, dass Intentionalität eine komplexe Beziehung ist. Für mich ist Angst ein sehr interessantes Phänomen. Ich habe mich schon seit dem Beginn meiner künstlerischen Tätigkeit mit Angst auseinandergesetzt. Dieses Gefühl ist für mich sehr vielschichtig. Angst ist eine der Grundbedingungen der menschlichen Existenz. Für mich ist sie aber nicht so negativ, wie sie gemeinhin dargestellt wird. Ich sehe in der Angst sehr viele Schattierungen – Angst kann ganz direkt sein, ohne Umschweife daher kommen, aber sie kann auch sehr kunstvoll kommen, sehr ausgefeilt sein. Angst ist zum Teil auch trickreich. Sie kann auch lustig sein, man sieht das am Galgenhumor, oder wenn jemand Selbstironie besitzt. Ich glaube, jeder Mensch muss eine gute Beziehung zu seinen Ängsten finden, und darin sehe ich auch positive Aspekte, denn Angst macht auch sensibler und aufmerksamer. Und das erscheint mir auch sehr wichtig: Angst fordert zum Reagieren heraus, zur Reaktion auf einen Umstand. Manche Gefühle sind eher tabuisiert. Ich glaube, die Angst gehört auch dazu, weil sie der Leistungsgesellschaft, in der wir leben, entgegengestellt ist. Angst bedeutet, schwach zu sein. Welche Emotionen sind die, über die man eher redet, und über welche redet man eher nicht?
TF: Ich würde jetzt nicht so weit gehen zu sagen, dass bestimmte Gefühle in unserer Gesellschaft ganz generell tabuisiert sind, aber sagen wir einmal, die „unangenehmen“ Gefühle sind jedenfalls die, in denen das Selbst in seinem Wert, in seinem Selbstwerterleben beeinträchtigt oder bedroht ist. Dazu gehört auch die Angst, weil es ja Ängste vor Selbstverlust und vor Statusverlust gibt, die in einer Gemeinschaft mit anderen besonders bedeutsam sind. Deswegen ist die Angst vor Statusverlust oder gar vor dem Ausschluss aus einer Gruppe eine ganz wesentliche Triebkraft für den Menschen. Weitere solcher Gefühle sind Scham und Schuld. Scham, weil sie unmittelbar die Erfahrung von Selbstwertverlust, von Peinlichkeit beinhaltet, die man vor anderen erlebt, und Schuld, weil man sich durch das Gewissen von anderen verurteilt oder vielleicht sogar ausgeschlossen fühlt. Das sind die zentralen Ängste, die zentralen Bedrohungen des Selbsterlebens für ein Wesen wie den Menschen, das ganz wesentlich auf Gesellschaft angewiesen ist. Deswegen wird man zumindest in der Öffentlichkeit versuchen, Gefühle von Scham – das gehört zu den katastrophalsten Gefühlen – auf jeden Fall zu vermeiden, auch möglichst nicht darüber zu sprechen, dass oder wessen man sich schämt. Also man kann leichter über Ängste sprechen, man kann noch einigermaßen über Schuldgefühle sprechen, am wenigsten aber über das, wessen man sich schämt, und da sind auch am ehesten die Tabus zu finden, die die Gesellschaft uns auferlegt… Peinlichkeitstabus, sexuelle Tabus, etwas, was man niemals vor anderen sagen würde, weil es einem so peinlich ist. Wenn Sie nach Gefühlen suchen, die am ehesten vor den Augen der Gesellschaft verschlossen oder verborgen werden, dann finden Sie sie am ehesten im Bereich der Scham.
PS: Scham hat – ich glaube, das geht auf Aristoteles zurück – den Sitz in den Augen. Und es ist ja auch so, dass man, wenn man sich schämt, oder wenn man in einer Situation besonderer Scham ist, dass Scham etwas wirklich Fundamentales hat, vielleicht ist sie auch deswegen so schlimm. Man kann dem Blick der anderen nicht standhalten, man wendet den Blick vor den anderen ab.
TF: Genau.
PS: In der Werkgruppe Elastic Punch habe ich einige Gefühle und innere Zustände untersucht, nämlich Angst, Freude, Unbehagen, Scham, Trauma und Lethargie. Das Thema Trauma würde ich gerne etwas näher besprechen. Wenn jemand etwas Traumatisches erlebt, dann geschieht das sehr unvermittelt. Die eigene Wahrnehmung, die eigene Person wird in den Grundfesten erschüttert. Das Ich wird, kann man sagen, aus der Bahn geworfen. Oft ist es so, dass der- oder diejenige das Gefühl hat, eigentlich tot zu sein, und dass quasi die Lebensvollzüge zum Teil nur mehr automatisch weitergeführt werden. Somit ist alles sehr eingeschränkt, und die Person ist wie gefangen in dieser Situation, die sie erlebt hat, die sie aber nicht vergessen kann. Was mich in diesem Zusammenhang auch interessiert, Sie haben in Ihrem Buch über das Vermögen gesprochen, was ich auch ein sehr gutes Wort finde. Ich denke, Vermögen ist auch, dass man etwas bewältigen kann, etwas tun kann. Beim Trauma schlägt das Vermögen aber in Unvermögen um, könnte man sagen. Es gibt auch den etwas in Vergessenheit geratenen Ausdruck, nämlich wenn es heißt: Er oder sie vermochte nicht dieses oder jenes zu tun. Hier zeigt sich meiner Meinung nach in der Konnotation des Begriffs Vermögen sehr deutlich, dass dem Vermögen ein existentieller Aspekt innewohnt. Jeder Lebensvollzug braucht in gewisser Weise ein Vermögen, um umgesetzt werden zu können. Und dieses nicht in der Lage zu sein ist ja auch beim Trauma im Spiel, oder? Der oder die Traumatisierte bleibt an dem negativen Schlüsselerlebnis hängen. Es ist vielleicht fast so, wie wenn im Trauma das Unmittelbare des Erlebten permanent unvermittelt bleibt. Vielleicht ist das auch das Schlimme daran, dass man da nicht wegkommt, dass die Erinnerungen nicht weggehen, dass das Erlebte nicht vergessen werden kann.
TF: Ja, ich gebe Ihnen in allem Recht. Ich kann nur ergänzen, dass die Erfahrung der Hilflosigkeit und der Ohnmacht in der Traumatisierung wirklich eine sehr tiefgreifende ist. Das Erlebnis, einer feindlichen oder bedrohlichen Einwirkung ausgesetzt zu sein und sich dagegen in keiner Weise wehren zu können, also wirklich die absolute Ohnmacht zu erfahren, gehört zentral zu dieser bleibenden Traumatisierung. Die Erfahrung also, sich in keiner Weise mehr als handelnd oder widerständig zu erleben, der traumatischen Einwirkung ohnmächtig ausgeliefert zu sein, das ist ein Schlüssel für das Verständnis. Das zweite ist, wie Sie zu Recht sagen, dass dieses Erlebnis unmittelbar bleibt und nicht verarbeitet wird im Sinne von Bewusstseinsprozessen, von Reflexionen, die das wieder einbetten könnten. Es kann nicht wirklich in ein Narrativ, in eine Erzählung gebracht werden und bleibt sozusagen unbegriffen. Es bleibt ein rein unmittelbares, maximal affektiv aufgeladenes Erleben, ohne dass es sich in eine Geschichte weiterführen lässt, die man dann sich selbst oder anderen erzählen kann, in der man so Distanz zu dem Ereignis herstellt. Stattdessen bleibt das Trauma als reine Unmittelbarkeit im seelischen, auch im leiblichen Erleben erhalten und kann jederzeit wieder in der ganzen Macht, in der ganzen Brutalität wieder aufbrechen. Dass es während des Traumaerlebnisses oft zu einer Entfremdung kommt – Sie sagten so etwas wie Todeserleben – das widerspricht dem nicht, sondern die Dissoziation, die dabei entstehen kann, dass man sich diesem Erleben entzieht, indem man das Bewusstsein von dem Schrecken und den körperlichen Einwirkungen gewissermaßen abzieht und nur noch ein entfremdetes, erstarrtes Empfinden behält, all das trägt eher noch zusätzlich dazu bei, dass das Trauma erhalten bleibt. Es gibt also eine Art Schutzmechanismus, der in der höchsten Bedrohung oder höchsten Qual auftreten kann, das ist die Dissoziation, das plötzliche Sich-Fremdwerden. Im 19. Jahrhundert hat man erstmals Berichte von Bergsteigern gesammelt, die aus großer Höhe stürzten, die aber hinterher gesagt haben, ich habe das nur beobachtet, ich habe nichts gespürt, ich hatte keine Angst und keinen Schmerz mehr, ich bin einfach nur gefallen. Da treten also Dissoziationsprozesse auf. Und das geschieht auch beim Trauma, bei schweren Traumatisierungen zum Beispiel durch andere Menschen. Die Dissoziation führt erst recht dazu, dass das Ganze nicht wirklich erlebt, verarbeitet und begriffen werden kann, sondern dass es als pures, namenloses Ereignis erhalten bleibt.
PS: Es fehlt dann vielleicht auch die objektivierende Leistung der Wahrnehmung, dass man das Erlebte und damit auch die eigene Person aus einer Distanz heraus sieht. Mit anderen Worten, dass man „einen Abstand“ hat.
TF: Ganz genau. Die Objektivierung und die Symbolisierung sind beide nicht möglich. Es wird nicht in eine Distanz gerückt, sodass ich es quasi noch einmal von außen anschauen und mir klarmachen kann, was geschehen ist, und ich kann es nicht in Worte fassen.
PS: Ich möchte jetzt zur Wahrnehmung kommen. Sie haben schon mehrmals ein sehr interessantes Beispiel thematisiert, nämlich die pathologische Wahrnehmung bei Schizophrenen, wenn sie etwa Bilder von Dingen sehen statt die Dinge selbst, und wenn ihnen ihre Umwelt wie eine Bühne oder eine Staffage erscheint, oder wie wenn ihnen ein Film vorgespielt würde. So nehmen sie die Umgebung wahr. Wie haben sich da die Grenzen des eigenen Ichs zur Außenwelt verschoben, und was ist mit der Wahrnehmung passiert?
TF: Die Wahrnehmung verliert in der akuten Psychose genau das, was Sie schon angesprochen haben, nämlich ihren Objektivitätscharakter. Wir hatten ja am Anfang festgestellt, dass wir als Menschen die Dinge nicht einfach auf uns bezogen wahrnehmen, sondern dass wir sie immer auch mit den Augen der anderen sehen, und dadurch werden sie sozusagen objektiv. Sie werden Dinge, die im Raum sind, die man von anderen Seiten auch sehen kann, die davon unabhängig sind, dass ich sie sehe. In der Schizophrenie geht diese Objektivität zumindest teilweise verloren, was man eine „Subjektivierung” der Wahrnehmung nennen kann. Alles ist auf mich gerichtet, auf mich bezogen, wegen mir da, es hat keinen unabhängigen Sachverhaltscharakter mehr, sodass es für Andere genauso da wäre oder von mir unabhängig ist; sondern alles, was die Wahrnehmung zeigt, ist auf mich bezogen, hat Bedeutung für mich. Diese Subjektivierung bedeutet nun auch, dass die Dinge zu schillern anfangen, dass man nicht mehr genau weiß, ist das nun wirklich eine Tasse, die hier steht, weil ich sie stehen gelassen habe? Ist das nun wirklich ein Fenster, durch das ich hinaus schaue? Könnte es nicht sein, dass diese Tasse irgendjemand so hingestellt hat, damit sie mir etwas zeigt? Schaut mich nicht durchs Fenster jemand an? Bin ich denn nicht für andere ständig sichtbar… Also die Dinge fangen an zu schillern und ständig etwas anderes anzudeuten, weil sie eben nicht mehr unabhängige Gegenstände sind. Sie bleiben sozusagen nicht mehr an ihrem Platz und erhalten einen übermäßig bedeutsamen Charakter. Das ist, was ich Subjektivierung der Wahrnehmung nenne. Man kann daran gut erkennen, was die Wahrnehmung normalerweise leistet: Dass sie nämlich die Dinge so zeigt, wie sie eben da sind. Dieser Schrank steht da. Sie schauen mich an. Die Lampe steht hier… Das ist alles gleichsam an seinem Platz. Subjektivierung heißt, dass alles plötzlich in Bewegung kommt und sich auf mich bezieht. Das ist eine schwere Störung der Wahrnehmung.
PS: Heißt das, die Wahrnehmung mit der räumlichen Tiefe ist nicht mehr gegeben?
TF: Nein, das würde ich so nicht sagen. Die räumliche Tiefe bleibt schon erhalten. Es ist nicht so, dass sich etwas verzerrt und die Abstände sich verkürzen, oder mir alles räumlich nahe rückt. Aber die Dinge bleiben nicht an ihrem Platz im Sinne von Gegenständen, die unabhängig von mir sind, sondern sie sprechen mich an, sie „springen mich an“, wenn Sie so wollen. Anspringen im affektiven Sinne, im Sinne der Aufmerksamkeit, die sie in mir wecken. Sie bleiben nicht an ihrem Platz, weil sie sich ständig auf mich beziehen, mir etwas zu sagen scheinen, etwas Wichtiges zu bedeuten scheinen. Ich weiß vielleicht noch gar nicht, was sie bedeuten, aber irgendetwas Wichtiges ist es.
PS: Wir kommen nun zum Schluss. Für mich ist Kunst der Versuch, die Unmittelbarkeit zu vermitteln. Die eigene Wahrnehmung finde ich dabei sehr wichtig und ebenso das implizite Können, was ein Zusammenspiel sein muss. Ich stelle mir Fragen über die Gesellschaft, über das Ich. Welche formale Umsetzung kommt dem eigenen Ich am nächsten? Und von daher sehe ich das Zeichnen und das Schreiben als formierenden Prozess. Für mich ist dabei wesentlich, dass die Gedanken eigentlich sehr unscharf sind. Sie formieren sich erst im Bewusstsein, mehr oder weniger. Erst wenn ich dann zeichne oder schreibe, setzt sich das um. Insofern sehe ich das als formierenden Prozess, der – sagen wir – unscharf, fuzzy ist. Das ist auch das Implizite, das der Tätigkeit des Zeichnens und Schreibens innewohnt. Für mich ist dabei auch die Vergegenwärtigung sehr wichtig, die wiederum mit dem Wahrnehmen einhergeht, aber es ist eine andere Form der Wahrnehmung. Mir ist nicht das Haus wichtig, wie es sich räumlich, zentralperspektivisch darstellt, mir geht es um den Wesenheitscharakter eines Hauses oder – um auf unser Thema zurückzukommen – eines Gesichts, weil ich auch dazu eine Serie gemacht habe. Ich wollte in dieser Serie das Wesen von Angst, von Freude, von Überraschung darstellen, und auch nicht-intentionale Zustände haben mich in Bezug auf ihre Wesenheit interessiert. Bei dieser Art zu zeichnen ist es wichtig, von sich selbst weg zu kommen. Aber es ist auch sehr wichtig, dass man wieder in diesen Prozess des aufs Papier Bringens eintreten kann. Das verbindet sich. Für mich ist im Prozess des Zeichnens und des Schreibens eine Konstante gleichbleibend, nämlich dass es während des Zeichnens keine Objektivierung gibt, sondern aus der eigenen Perspektive erfolgt. Das Überprüfen, das gewissen Kriterien standhalten muss – das kommt dann erst viel später, wenn ich selektiere, nachdem die Zeichnung oder die Serie schon lange fertig ist. Gerade das Implizite finde ich an meiner künstlerischen Arbeit sehr wichtig, weil es das Körperliche und das Leibliche zusammenbringt. Es steht für mich fest, dass man das Tun und die Vorstellung – oder man kann auch sagen, die Vorstellung und das Tun – nicht voneinander trennen kann. Und so möchte ich auch unser Gespräch mit einem Zitat von Ihnen ausklingen lassen. Sie sagen, „Bewusstsein ist nicht ‚im Körper‘, sondern es ist verkörpert.“
Thomas Fuchs, Das Gehirn – ein Beziehungsorgan. Eine phänomenologisch-ökologische Konzeption. Kohlhammer, Stuttgart 2008