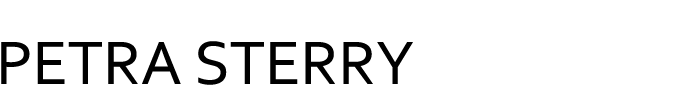Die versiegelte Tür wird erbrochen. Der gewaltsame Zugang als Geste der Freiheit (miss)verstanden, soll verschlossene Bereiche eröffnen. Doch das Geheimnis entzieht sich, der erbrochene Raum erweist sich als leer, was bleibt, sind Schuldgefühle und Angst.
Wir kennen diese Geschichte aus Mythen und Märchen. Sie wurzeln in existentieller, sehr realer Erfahrung, und auch wenn sie in simplen, scheinbar harmlosen Kinderreimen daherkommt, sollte sie nicht darüber hinwegtäuschen, welche Abgründe sich hinter ihr verbergen.
Allein die Sprache vermag es, noch heute wie eh und je, die Dämonen zu bannen. Mitunter dauert es lange, bis über traumatische Erfahrungen gesprochen werden kann. Sie beim Namen zu nennen, ist häufig schon Indiz der Heilung, jedenfalls allemal Zeichen der Distanzierung, der Objektivierung.
Signalhaft plakativ kommt die Sprache daher in den Bildern der Petra Sterry, in diesem Fall auf rotem Grund, sonst meist auf Schwarz, und es ist tatsächlich die Sprache, die sich sehr energisch zu Wort meldet, denn in scheinbar naiver, scheinbar ironisierender Weise hat sie sich dem Korsett orthografischer Konventionen zugunsten einer frappierenden phonetischen Unmittelbarkeit entwunden. Einer Unmittelbarkeit, die im Visuellen als Verfremdung in Erscheinung tritt und somit eine Spannung erzeugt, die auf andere Weise auch im Duktus der Schrift erfahrbar wird:
Mehr lesen / Read more ...
Es entsteht so etwas wie ein Spannungsfeld zwischen Normen und deren Überschreitung, zwischen Objektivität und Subjektivität, zwischen Realem und Irrealem. Das Rituelle und Zwanghafte einer Suche nach Freiheit wird gleichsam mit dessen eigenen Waffen bekämpft, der Teufel durch Beelzebub ausgetrieben.
Was in diesen sechs Tüchern in merkwürdiger Ambivalenz immer drängender und bedrängender aufscheint, verrät in den visuellen und lautmalerischen Rhythmen von Schriftbild und darin vergegenwärtigter Sprache etwas von dem unbändigen Willen, sich über Konventionen hinwegzusetzen, dabei aber zugleich der Gefahr, in die Falle anderer, womöglich noch viel bedrohlicher Zwänge zu geraten.
Die Folge selbst – wie gesagt, auf blutrotem Grund eine Schrift, die ein wenig an die von Ben Vautier oder auch an die obsessiven Notizen und Markierungen des August Walla erinnert, lebkuchenhaft (lauert da nicht irgendwo die Hexe, die Hänsel und Gretel mästen verschlingen will?), weiß-rot-giftig fliegenpilzhaft – entwickelt von Bild zu Bild ein Crescendo an Dramatik: Auf den vergleichsweise harmonischen Anfang, der mit eher sympathischen Begriffen immerhin recht beunruhigende konfrontiert („zehn änxte“, „Schädel“) folgen zwanghafte Stabreime, das Wortmonster „zwanxanxt“ beherrscht im folgenden die Szene, bedrängende Enge, obsessives Repetieren. „(Solst du liben solst du liben solst du liben“) mündet in den Aufschrei der drei „O“, deren eines, zwischen „not“ und „tot“ eine Null, das Zeichen des Nichts, des endgültigen Verlöschens, ist.
Diese Null aber ist Teil der Doppelziffer „10“, womit sich die Aufzählung der Ängste erschöpft – ein makabrer Dekalog, der unweigerlich zum Tod führt.
Der Schlaf der Vernunft gebiert Ungeheuer. Ängste kann man nicht benennen, man kann sie allenfalls aufzählen. Die eine erzeugt die zweite, diese die dritte, vierte und fünfte. Wo bleibt Herakles, der der Hydra den Kopf abschlägt?
Ein Kreislauf des Unheils auf dem roten Fonds des Blutes. Farbe des Feuers, Signal der Liebe, Hilferuf. Ein Kinderreim schließlich bannt die tödliche Bedrohung, hält das immer schneller rotierende Rad eben noch rechtzeitig an, erinnert sich elementarer Kräfte der Heilung. Aus dem Spiel erwächst eine neue Dimension der Freiheit.
Die Arbeit handelt, wie alle Arbeiten der Petra Sterry – seit 1991 entstehen auch Schriftbilder, daneben u.a. auch Fotoarbeiten – von der eigenen Person, von Rollenspiel und Bewusstseinsspaltung, von Angst, Gewalt, Sexualität, Kindheit und Doppelleben, von den mindestens zwei Seelen in mindestens einer Brust, von den zwei Gesichtern des Janus. Doppelbedeutungen werden auch im Schriftbild markiert: Das Mädel „iisst“, und als keineswegs nur doppeldeutig erweist sich dann auch der Titel der Arbeit: Das erbrochene Paradies. Es bedurfte einer weiteren, weitaus größeren Anstrengung, die Tür des Rückzugs aus dem Paradies des Todes in die Welt der Desillusionierung wieder zu öffnen, aus der Illusion des Absoluten in die Realität des Relativen zu gelangen, von den Zwängen der Freiheit eines souveränen, spielerischen Umgangs mit Zwängen.
Lakonisch vermerkt die Künstlerin:
„Ich hatte, seit ich sechzehn war, Bulimie, und weil diese extreme Lebensweise mein Leben sieben Jahre lang vollkommen beherrschte, gibt es diese Arbeit mit dem Titel „Das erbrochene Paradies“.