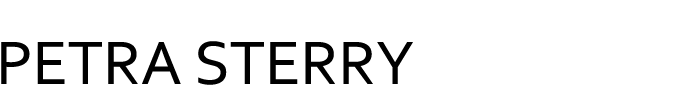1. St. Aigenheim
Das Wackelbild der Kamera hält die trauteste Nachmittagsidylle fest. Ein Wäldchen, ein Weg, eine Wiese im Sonnenschein, zwei Mädchen spielen, ein kleiner Hund spielt mit. Summer Tale nennt Petra Sterry ihre Filmarbeit, und auch wenn es ein Gewitter zu geben scheint, hat das Freundliche am Alltäglichen dieses Sommermärchen fest im Griff. Allerdings gibt es da, dem Medium gemäß, auch eine Tonspur, und die erzählt durchaus von dem, was auch die Bilder erzählen, wäre da nicht dieser Nebenschauplatz außerhalb, bei dem von einer Mutter die Rede ist, einem Kleiderhaken und einem Hund, der sich voller Furcht und blutender Nase in die Ecke duckt. Diese Geschichte in der Geschichte ist ausschließlich akustisch zu verfolgen, doch womöglich hat sie sich auch in die Unschärfe der verwischten Bildsequenzen eingeschlichen, und so wird urplötzlich plausibel, was der Schlusssatz des kaum achtminütigen Minidramas zu verstehen gibt: „Der Nachmittag hat seine Unschuld verloren“.
Nichts ist wie es ist, scheinen diese Oberflächen artikulieren zu wollen, und gerade die Evidenz hat ihre Hinter-, ihre Untergründigkeit. „St. Aigenheim“ ist ein kalter Ort, gibt die Künstlerin auf einem ihrer Gemälde zu verstehen; das Eigenheim ist heilig, doch ist bei diesem St. Aigen jederzeit mit Sanktionen zu rechnen. Minimale Verschiebungen, subtile Brechungen, ein versetzter Buchstabe im Wort oder ein verrücktes Motiv in der Abfolge der Bildgegenstände reichen, um das Heimelige mit jener Dimension anzureichern, die ihm bereits die Etymologie verschreibt, das Un-Heimelige, das Unheimliche. Es ist die Domäne von Petra Sterrys Bildwelten.
An den Anfang des Klassikers zum Thema, des 1919 erschienenen Aufsatzes „Das Unheimliche“ setzt Sigmund Freud ein langes Zitat aus dem Wörterbuch. „Am interessantesten“ sei, so Freuds Resümee, „dass das Wörtchen heimlich unter den mehrfachen Nuancen seiner Bedeutung auch eine zeigt, in der es mit seinem Gegensatz unheimlich zusammenfällt“. Dieser Synonymität widmet er die folgenden Ausführungen, und Petra Sterry scheint diese Ausführungen sehr genau zu kennen. Vom Traulichen zum Grauslichen ist es nur ein kleiner Schritt. Der Terror liegt auf dem Trottoir, und je beflissener man sich abschottet in seine kleine Welt hinein, um so strammer stehen die Dämonen bei Fuß.
Das Unheimliche hat Konjunktur bekommen in den letzten eineinhalb Jahrzehnten. The Archi-tectural Uncanny war Anthony Vidlers 1992 publiziertes Werk über das „Unbehagen in der modernen Architektur“ überschrieben, das seinerseits jenen Zusammenhang dingfest machte, wie ihn die deutsche Übersetzung dann als Titel hatte: unHEIMlich. Mike Kelley organisierte dann im Jahr 2004 eine Ausstellungstournee zum Thema „The Uncanny“ und machte den Spagat vom Heimeligen zum Unheimlichen gewissermaßen bühnentauglich. Doch war das eher eine späte Blüte. Mit Petra Sterrys unnachahmlich austriakischen Anglizismen ließe sich längst sagen: An kenn i.
2. Our Nature Is a Dress Code of the Nada
Das Blatt 69 von Francisco Goyas Desastres de la guerra hat das Motto „Nada. Ello dirá”, „Nichts. Es wird sich zeigen“. Diese für die Folge seiner Kriegsdarstellungen ungewöhnliche, weil die Nachvollziehbarkeit des Sichtbaren hinter sich lassende Darstellung zeigt eine bereits mumifizierte Leiche, die in einer Art posthumer Kraftanstrengung auf die Sinnlosigkeit – des Daseins, des Krieges, der eigenen Existenz – hinweist, indem sie zum Schreibstift gegriffen hat. So kritzelt die lebende Leiche also ein einsames, sehr leserliches und mit Großbuchstaben beginnendes „Nada“ auf die Platte, die an seine Hüfte gelehnt ist. Das Nichts, es steht buchstäblich geschrieben. Die leere, nackte Evidenz, dass alles ist, wie es ist, bringt Goya hier ins Spiel, das pure Sic, zu dem es nichts gibt, was es überstiege. Nichts, außer dem Unheimlichen. Es lebt ausschließlich vom Verdacht, aber es lebt. Ein Skelett, wie Goya es aus der Tradition des Totentanzes ableitet, ist die gewissermaßen traditionelle, jedem Kind vertraute, das Unausprechliche mit dem Unabänderlichen kurzschließende Darstellungsform dafür, eine Personifikation, die alles Personale längst hinter sich gelassen hat.
Auch Petra Sterry bedient sich bei ihren Strichgestalten, zombiehaft, untot, mumifiziert, die sie in ihre neunteilige Zeichnungenfolge The So-called Nada einbaut, aus diesem Fundus. Das Nichts lauert ohnedies überall, und es ist das Fanal jedes Terrors, wie ihn die Moderne kennengelernt hat: Es ist schlimmer als die Hölle, die das Schrecklichste war, was es vorher gegeben hatte. Schlimmer als alles ist jetzt die Tatsache, dass nichts ist. Nichts, kleingeschrieben, und so brach sich die „Maladie du siècle“ des 19. Jahrhunderts die Bahn. Schlimmer als die Hölle ist die Langeweile. In der Entdeckung des „Ennui“ fand die Ästhetik des Sublimen, wie Goya sie festgestellt hatte, nunmehr ihre Zukunft. Hier hatte die Simultanität von heimelig und unheimlich ihren neuen Ort, ihr buchstäbliches Zuhause, denn gerade im eigenen Interieur tat sich der Abgrund auf.
Charles Baudelaire, der Dichter des „Ennui“ und Übersetzer Edgar Allan Poes, war der Programmatiker einer solchen Komplizenschaft des Situierten mit dem Sinistren. Und es hat seine eigene kulturgeschichtliche Richtigkeit, wenn Petra Sterrys „Nada“-Zyklus die zombiehaften Figurinen in Kombination setzt mit großformatigen Lettern, die die Bildoberfläche überziehen und eine eigene Lage an Sinn- und Widersinnstiftung einziehen. Dieser Zyklus funktioniert als Palimpsest, als Übereinander von Schichten, die einander durchaus entsprechen, aber auch jeweils eigene Deutungshoheiten beanspruchen. „Palimpsestes“ hatte Baudelaire einen Text benannt, den er in seine Anthologie zu den Paradis artificiels aufgenommen hatte – den künstlichen Paradiesen als dem Einzigen, was einem bliebe im Zeitalter der Langeweile. Palimpseste, in ihrer Schichtung, ihrer Transparenz und Opazität, in ihrem Prinzip der Sedimentierung und des Übereinanderschreibens, seien, so Baudelaire, nichts anderes als eine Funktionsweise des Gedächtnisses. Und zwar jene, in der das „Unausweichliche“ geschieht, da sich unser „Geist jenen Partien an uns selbst zuwendet, denen wir nur mit Schrecken die Stirn bieten können“. Im Palimpsest findet das Unheimliche zu sich. Eben das passiert bei Petra Sterry.
3. Poni om e Cent
In seiner Grammatologie zitiert Jacques Derrida eine bezeichnende Stelle aus den Bekenntnissen Jean-Jacques Rousseaus. Darin erinnert sich der moderne Gründervater einer Episode, die seine Affenliebe zu seiner Ziehmutter illustrieren soll: „Einst rief ich bei Tische, als sie eben einen Bissen in den Mund gesteckt hatte, dass ich ein Haar daran sehe. Kaum aber war der Bissen wieder auf dem Teller, so ergriff ich ihn und schlang ihn hinunter.“ Für das „Close Reading“ Derridas und seines Kreises ist die Geschichte bezeichnend, denn es ergibt sich eine spezielle Bedeutungsverschiebung, wenn man die Dinge beim Wort nimmt. „Ein Haar“ heißt auf französisch „un cheveu“, und doch ist es für die, natürlich psychoanalytisch geschulte, Methode der Dekonstruktion evident, dass es sich genauso um „un je veux“ handelt, um ein „Ich will“, in dem sich das Begehren mächtig meldet. Derridas Verfahren ist eine Schule des Unheimlichen, und der Abgrund ist, als „abyme“, ohnedies einer ihrer Code-Begriffe.
Petra Sterrys eigenes Verfahren der Sinn-Verschiebung ähnelt diesem „Close Reading“. Es geht bei den vielerei Wortspielen, für die sie, man könnte sagen, berühmt ist, nicht allein um das Zusatzreservoire an Lesart, das sich ergibt, wenn man Poni om e Cent als Anagramm von „omnipotence“ liest oder TX Nano Is Ulli als Palindrom von „Illusion Anxt“ nimmt. Anagramme − man denke an André Bretons schöne Abwandlung von Salvador Dali zu einem seine Geldgeilheit auf den Punkt bringenden „Avida Dollars“ – und Palindrome – André Thomkins hat sein Lebenswerk darauf aufgebaut und etwa „Dogma I am God“ oder „Nie Reime, da kann Akademie rein“ ersonnen – sind im Kunstbetrieb gang und gäbe. Es ist indes die Engführung auf das Unheimliche, in der Petra Sterrys Oeuvre zu sich kommt, es ist der Tunnelblick auf die Gefahren und Gefährdungen, die um so ständiger lauern, je beflissener man sie einwattiert ins Gemütliche.
Das Unheimliche ist wirksam, weil das Vertraute, so formuliert Freud es in seinem einschlägigen Aufsatz, „durch den Prozeß der Verdrängung entfremdet worden ist“. So sagt es der Psychologe, doch um eine Ästhetik daraus zu machen, eine Arbeitsprämisse und eine künstlerische Methode, sollte man es vielleicht andersherum sagen: Nicht durch Verdrängung entfremdet, sondern durch Entdrängung verfremdet. Petra Sterrys Arbeiten funktionieren über Verfremdung. Und sie sind möglich, weil Sexualität nicht mehr verdrängt wird, sondern im Gegenteil omnipräsent ist, als Libertinage und Obsession, als Lebenszweck und als Verdacht, als Bekenntnisformel und als vitales Programm. Das Unheimliche, das Petra Sterry speziell um die Sexualität rankt, kann nur entstehen, weil die Sexualität als Massenphänomen alles Geheimnisvolle, Mysterienträchtige und Umwitterte gerade verloren hat.
Das Unheimliche entsteht hier, im Umweg über die Kunst, durch die Verfremdung. „Um nun die Empfindung des Lebens wiederzugewinnen, die Dinge wieder zu fühlen, den Stein steinern zu machen, gibt es das, was wir Kunst nennen. Ziel der Kunst ist es, ein Empfinden für die Dinge zu vermitteln, das sie uns sehen und nicht nur wiederkennen läßt.“ Diese Sätze stammen von Viktor Šklovskij, dem einflussreichen Theoretiker des russischen Konstruktivismus, geschrieben im Jahr 1917. „Kunst als Verfahren“ ist der Text betitelt, in dem Šklovskij auch einen Vorschlag parat hat, wie man das gesteigerte Empfinden eines Lebens, das man sieht und nicht nur wiedererkennt, herzustellen hat. Šklovskij nennt dieses Verfahren „Verfremdung“. Es soll dazu führen, dass man genauer hinblickt und damit den Dingen die Selbstverständlichkeit nimmt, mit der sie bis dato nichts anderem als der Gewohnheit gedient hatten. Verfremdung ist ein veristisches Verfahren, denn es möchte eine Wahrheit erkennen lassen, die sich auftut hinter dem Schutt der Routinen.
Petra Sterrys Schaffen ist eine Arbeit an der Verfremdung. Und es ist ein Schritt weiter, denn es geht nicht nur um die Kenntlichkeit der Dinge, sondern um die gesteigerte Präsenz. Die Routinen sind mächtig, übermächtig geworden in der Gegenwart. Das Unheimliche aber ist die Gegenmacht.